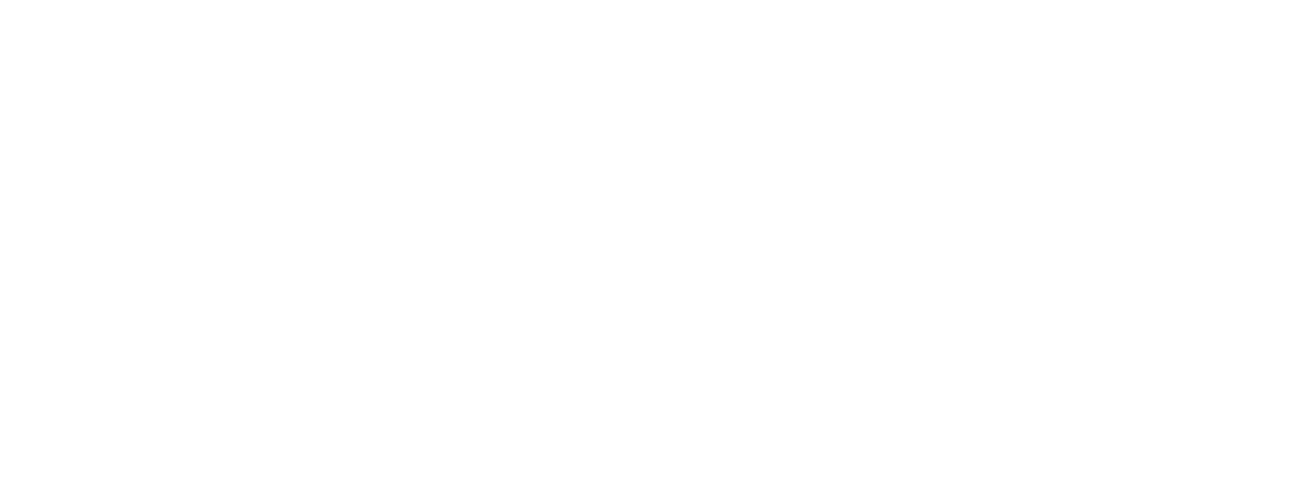TFA auf Abwegen – Ein Nachtrag
Dieser Blog-Beitrag baut auf dem Beitrag von 2022: TFA auf Abwegen auf. Es wird empfohlen, den älteren Beitrag zuerst zu lesen.
Auch zweieinhalb Jahre nach dem letzten Blog-Beitrag zu TFA wird dieser Stoff noch immer in die Umwelt und den Wasserkreislauf eingetragen. Außerdem gibt es nach wie vor kein finanzierbares Verfahren, um TFA aus Trinkwasser zu entfernen.
Dennoch hat sich einiges geändert: Ein Pestizid-Wirkstoff hat unter anderem deswegen keine Zulassung mehr erhalten, weil er beim Abbau zu viel TFA freisetzt. Die TFA-Konzentrationen im Rhein haben sich innerhalb von acht Jahren verdoppelt und auch in Pflanzen ist immer mehr TFA enthalten. Und ganz neu: Deutsche Behörden haben eine neue Klassifizierung von TFA beantragt. TFA soll fortpflanzungsgefährdend sein. Um diese Themen soll es im Folgenden gehen.
PM mit oder ohne „T“?
PM – was soll das schon wieder heißen? PM war TFA schon von Beginn an. P steht für persistent und M für mobil. Das bedeutet, dass TFA sehr stabil ist und in der Umwelt – nach aktuellem Kenntnisstand – nicht abgebaut wird und sich überall im Wasserkreislauf verteilen kann. Bisher galt, dass es kein „T“ gibt. Also, dass TFA nicht toxisch ist. Das könnte sich jetzt ändern.
Verschiedene deutsche Behörden haben aufgrund von neuen Daten bei der ECHA, der Europäischen Chemikalienagentur, einen Antrag eingereicht, um die Eigenschaften von TFA in der gesamten EU gleich einzustufen. TFA soll dabei nicht länger harmlos, sondern fortpflanzungsgefährdend sein. Bevor so etwas beschlossen wird, werden einige behördliche Verfahrensschritte benötigt: Diskussionen, Fristen, Ausschüsse und viel Zeit. Vielleicht ein Jahr oder mehr. Erst dann ist klar, ob TFA wirklich als fortpflanzungsgefährdend eingestuft wird. Nach wie vor gilt, dass die bisher im Wasser vorhandenen TFA Konzentrationen zu gering sind, um negative gesundheitliche Wirkungen beim Menschen hervorzurufen. Allerdings kann die einheitliche Einstufung von TFA dafür sorgen, dass beispielsweise Pestizide nicht weiter zugelassen werden, die TFA beim Abbau bilden. Damit würde sich zumindest der Eintrag von TFA aus der Landwirtschaft deutlich verringern (Umweltbundesamt, 2025).
Ein Unglück kommt selten allein
Flufenacet, der Pestizid-Wirkstoff, der beim Abbau TFA bildet, hat keine Verlängerung seiner Zulassung erhalten. Einer der beiden Gründe dafür ist TFA (Umweltbundesamt, 2025). Doch man muss nicht denken, dass alle TFA-Einträge aus der Landwirtschaft damit Geschichte sind. Flufenacet ist nicht der einzige Pestizid-Wirkstoff, der TFA bilden kann, wenn er in der Umwelt abgebaut wird. Weitere potentiell TFA-freisetzende Pflanzenschutzmittel tragen tolle Namen: Diflufenican, Fluazinam, Tritosulfuron, Tembotrione, Fluopyram, Fluaziflop-P, Trifloxystrobin, Fluopicolide, lambda-Cyhalothrin, Flonicamid. Eine lange Liste an Stoffen. Leider. TFA wird uns noch lange begleiten und es wird erkennbar, dass immer mehr TFA in der Umwelt bleibt.
Doppelt so viel TFA wie vor 8 Jahren?!
Ein Zusammenschluss von Wasserwerken entlang des Rheins misst regelmäßig die TFA-Konzentrationen in dem Wasser, das sie zu Trinkwasser aufbereiten. Jetzt schlagen diese Wasserversorger Alarm. Von 2016, dem Jahr in dem TFA erstmalig im Rhein gefunden wurde, bis heute hat sich die Konzentration des Stoffes verdoppelt. Das betrifft sehr wahrscheinlich nicht nur den Rhein, sondern viele andere Fließgewässer und Seen. Der Zusammenschluss der Wasserwerke kommt zum Schluss, dass es nach wie vor kein finanzierbares Verfahren gibt, wie man TFA wieder aus dem Wasser herausbekommt. Somit bleiben nur Maßnahmen, die den Eintrag von TFA verhindern (AWBR, 2025).
Lapidar formuliert: Also nicht fröhlich alles verschmutzen, weil man sowieso die unerwünschten Stoffe irgendwie mit verschiedenen technischen Verfahren wieder herausfischen kann, sondern weil dieses Mal gilt: Die Umwelt am besten gar nicht mit TFA verschmutzen, weil TFA die Technik an ihre Grenzen bringt.
„Wenn für TFA ein Trinkwassergrenzwert eingeführt wird, dürfte es angesichts der flächendeckenden und irreversiblen Gewässerbelastung unmöglich sein, diesen einzuhalten.“
Matthias Maier, AWBR
Das Gedächtnis der Natur
Die Umweltprobenbank des Bundes ist eine feine Sache. Es ist eine Bibliothek, in der allerdings keine Bücher, sondern Umweltproben archiviert werden. Seit den 80ern werden hier Proben von Pflanzen, Tieren und Menschen eingefroren. Es kann sein, dass ein neuer Stoff in der Umwelt gefunden wird (TFA: hust hust), der Jahre zuvor gar nicht untersucht werden konnte, weil die Geräte und die Technik noch nicht so weit waren. Dann kann mithilfe der eingefrorenen Proben ein Blick in die Vergangenheit gewagt werden. Fragen wie: Gab es diesen Stoff schon vor 30 Jahren in der Umwelt? Hat sich seine Konzentration erhöht? Gibt es Pflanzenarten, die mehr von dem Schadstoff aufnehmen?, können so beantwortet werden. Genau das wurde mit TFA gemacht. Es wurden Proben von Bäumen untersucht, die von 1989 bis 2020 von der Umweltprobenbank archiviert wurden. Dazu gehörten Rotbuche, Pappel, Fichte und Kiefer aus unterschiedlichen Standorten Deutschlands. Zwar gibt es kurzzeitig Schwankungen, aber über die betrachteten 30 Jahre kann gesagt werden, dass die Bäume mehr TFA in sich tragen.
Untersuchungen von Regen deuten daraufhin, dass mehr TFA in den letzten Jahrzehnten in die Atmosphäre gelangt ist und mit dem Regen wieder auf die Erde zurückkommt. Da das TFA sehr beweglich und stabil ist, kann man davon ausgehen, dass mit den höheren Konzentrationen im Regen auch die Konzentrationen in den Pflanzen steigen, auf die es runterregnet (Umweltprobenbank, 2025), (Freeling, Scheurer, 2021).
Und somit gilt weiterhin das Fazit, das vor zweieinhalb Jahren gezogen wurde. Der Eintrag von TFA in die Umwelt muss schnellstmöglich reduziert werden. Angesichts neuer Erkenntnisse ist diese Forderung sogar noch dringlicher geworden.